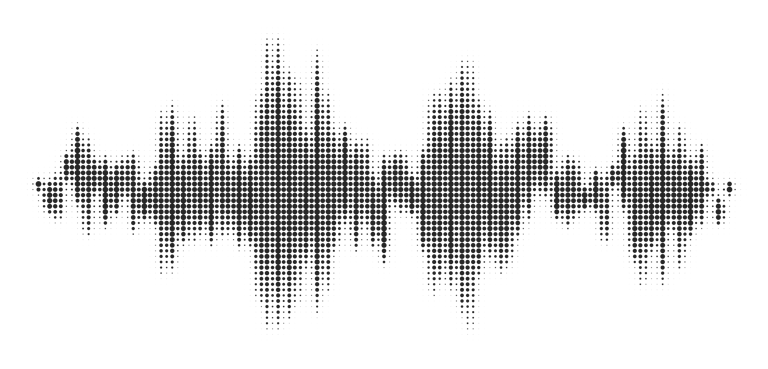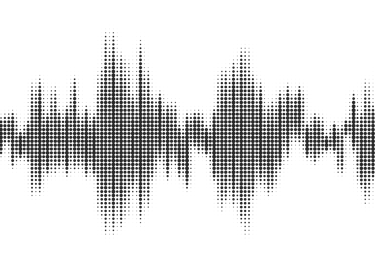Schreib einen Roman!
Die Idee, einen Science-Fiction Roman zu schreiben, war schon lange da. Doch sie musste erst reifen. Und etwas, musste sterben...
Luk Schmid
2/18/2025


Nachdem ich mein DJ/Producer-Projekt im Februar 2023 definitiv auf Eis gelegt hatte und mich nach einigen Monaten auch geistig davon lösen konnte, spürte ich, dass sich Raum für eine neue, musische Tätigkeit auftat. Ich möchte nicht sagen, es war ein Befreiungsschlag, das klänge zu dramatisch, schliesslich war die Musikproduktion ein treuer Begleiter während 20 Jahren und gab mir immer das Gefühl, mich kreativ austoben zu können. Aber ich spürte, dass mir Inspiration und auch die Energie für die zahlreichen Auftritte langsam abhanden kam und mich die Szene zu langweilen begann. Hinzu kam der Impuls, mir den Wunsch zu erfüllen, der schon seit Jahrzehnten in mir schlummerte: Schreib einen Roman!
Ich war motiviert und hatte Bock auf ein neues Langzeitprojekt. An Ideen, hat es mir nicht gemangelt. Über Jahre, notierte ich mir in Stichworten mögliche Themen und Inputs in einer losen Ansammlung von Geistesblitzen, alles weit entfernt von Struktur und rotem Faden. Das einzige was klar war, war das Genre. Seit meiner Kindheit bin ich begeisterter Fan der Science-Fiction. Mein Vater war leidenschaftlicher Perry Rhodan Leser und ich erinnere mich, lange bevor ich lesen konnte, an die fantastischen Covers der Hefte die mich mit Sicherheit damals schon prägten. Mich faszinierte immer schon die grenzenlose Fantasie über visionäre Ideen, technischen Möglichkeiten der Zukunft gekoppelt mit einer fesselnden Story. Die Wissenschaft lässt es in diesem Genre zu, die Fäden weiterzuspinnen und Fakten mit Fiktion zu verknüpfen. Genau mein Ding!
Die literarischen Genre-Klassiker von Asimov, Heinlein, Clarke, Adams und Co. hatte ich bereits in meinen 20ern verschlungen. Aber auch die moderne deutsche Science-Fiction geprägt von Eschbach, Brandhorst, Klein, Schätzing und Peterson hatten (und haben) einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ich war also reif genug, mich ins Abenteuer Romanschreiben zu stürzen. Ich hatte grossen Respekt vor dieser Mammutaufgabe aber zu meiner eigenen Überraschung war das 550seitige Rohmanuskript nach drei Monaten bereits fertig gestellt. Einfach so, ohne zermürbende Ideenlosigkeit oder gar einer Schreibblockade. Das Ding ging mir so locker von der Hand , dass ich mir ernsthaft Sorgen machte, mir wieder eine neue Freizeitbeschäftigung suchen zu müssen.
Der Prozess war dennoch kein einfacher. Das Schreibhandwerk ist das eine – daran feile ich selbstverständlich immer noch und werde es vermutlich mein Leben lang tun. Schließlich hat mein persönliches Abenteuer als ambitionierter Schreiberling gerade erst begonnen. Was mir während des Schreibens jedoch bewusst wurde, war, dass man als Autor eine Strategie verfolgen sollte. In der Schriftstellerei gibt es offenbar zwei, vielleicht drei Herangehensweisen an einen Roman. Die einen beginnen mit einer Plotstruktur. Die Handlungsstränge werden zuerst umrissen oder sogar bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, noch bevor das erste Wort der eigentlichen Geschichte geschrieben wird. Das klang für mich furchtbar systematisch und öde – und ich merkte schnell, dass ich zur zweiten Gruppe gehöre: den sogenannten Discovery Writern. Bei dieser Herangehensweise entwickelt sich die Geschichte während des Schreibens. Das erlaubt wahnsinnig viel Freiheit und kann Barrieren aufbrechen, die man sich vielleicht unbewusst beim Plotten gesetzt hätte. Gleichzeitig besteht aber die Gefahr, sich zu verzetteln. Gerade bei umfangreichen Werken kann es passieren, dass man die verschiedenen Handlungsstränge nicht mehr kohärent zusammenbringt. Auch bei meinem Roman kam im letzten Viertel der Geschichte der Moment, in dem ich doch rückwirkend strukturell nachgeplottet habe, schlicht und ergreifend, weil die Handlung meines Debütromans Synchromancer komplexer wurde, als ich es zu Beginn beabsichtigt hatte. Das kann beim Drauflosschreiben schon mal passieren.
Nach der Fertigstellung des Rohmanuskripts von Synchromancer folgte ein Jahr mit mehreren Überarbeitungsschritten: eine Manuskriptbegutachtung durch die sehr geschätzte Lektorin Lisa-Reim Benke, einem kurzen Coaching von Andreas Schuster sowie Feedback einiger Testleser aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an Lisa, Andreas, Simon, Seydi, Joern und meine Partnerin Daniela für eure Zeit! Eure Inputs waren nicht nur äußerst hilfreich, sondern vor allem auch motivierend.
Schließlich bewarb ich mich mit Exposé und Leseproben bei Literaturagenturen – von denen sich genau eine nach zehn Monaten mit einer Absage zurückmeldete. Ähnliches galt für die Publikumsverlage. Die Branche ist tatsächlich knüppelhart, musste ich feststellen. Ich las, dass selbst ein Indie-Verlag im Fantasybereich innerhalb von zwei Monaten 350 unangeforderte Romanmanuskripte erhält – eine unglaubliche Zahl. Es wird also deutlich mehr geschrieben, als letztlich veröffentlicht wird. Hinzu kam der Disclaimer von 80 Prozent der Agenturen und Verlage, dass sie keine Science-Fiction unter Vertrag nähmen.
Okay, das könnte harzig werden …
Nach knapp einem Jahr ohne den Hauch einer Aussicht auf einen Verlagsvertrag schlichen sich Zweifel ein. War mein Schreibhandwerk nicht gut genug? Die Geschichte nicht fesselnd? Das Thema nicht relevant? Das Genre zu exotisch? So langsam machte ich mich mit dem – zugegebenermaßen für mich unangenehmen – Gedanken vertraut, mein Werk im Self-Publishing zu veröffentlichen. Ich möchte keineswegs das Konzept des Self-Publishing schmälern – ganz im Gegenteil: Es erscheinen grossartige Bücher im Bereich Self-Publishing und ich bewundere den Enthusiasmus vieler Self-Publisher, die ihre Werke mit Hingabe promoten und teils große Erfolge feiern. Aber ich habe schlichtweg nicht die Muse, geschweige denn die Zeit, ein Netzwerk aufzubauen und Self-Promotion in dieser immensen Form zu betreiben. Das erschien mir schon als DJ und Produzent ziemlich mühsam.
Doch dann kam die Wende: Innerhalb von vier Wochen meldeten sich insgesamt fünf Indie-Verlage bei mir und bekundeten Interesse, Synchromancer in ihrem Haus zu veröffentlichen. Darunter auch einer meiner Favoriten, der noch junge und dynamische LeeBooks-Verlag, der sich auf Science-Fiction und Fantasy spezialisiert hat. Ich war hin und weg! Ganz egal, ob sich mein Buch in der Zukunft gut oder schlecht verkauft, ob es Anklang findet oder nicht – für mich war der Moment, in dem ich den Vertrag in den Händen hielt, einer der größten und erfreulichsten Erfolge meines Lebens. Vielen Dank an dieser Stelle an Leander und Sarah für euer Vertrauen und euren Mut, meine abgefahrene Geschichte in euer Portfolio aufzunehmen!
Gegenwärtig gebe ich meinem Manuskript den letzten Schliff, bevor es im November 2025 ins Lektorat geht. Ich freue mich bereits auf diesen – auch für mich neuen – Prozess und auf die Zusammenarbeit mit der Lektorin Sarah Nierwitzki von Wortkosmos.
Zum Buch:
Tja, im Nachhinein wird mir schon klar, warum keine Literaturagentur Interesse an meinem Manuskript hatte. Das Genre meines Romans will sich irgendwie nicht so recht bändigen lassen. Tatsächlich lässt sich Synchromancer schwer kategorisieren. Und wie ich mir sagen lassen habe, sind die Zeiten vorbei, in denen Agenturen und Publikumsverlage experimentierfreudig waren und auch mal ein Wagnis mit genreübergreifender Belletristik eingingen. Heute orientiert man sich an Trends und ist in erster Linie daran interessiert, was sich gut verkaufen lässt. Raum für Experimente und Risikobereitschaft sind kaum noch vorhanden. Aus rein markwirtschaftlicher Sicht, ist diese Haltung natürlich völlig nachvollziehbar.
Umso erfreuter war ich, als ich im persönlichen Gespräch mit Leander, meinem Verleger bei LeeBooks, erfuhr, dass ihre Philosophie eine andere ist – nämlich genau diese Nische zu füllen. Und zwar mit genreübergreifenden Werken, für die es mit Sicherheit nach wie vor eine Leserschaft gibt und die es zu schätzen weiß, dass es neben dem Mainstream noch viel zu entdecken gibt. Diese Ansichten, waren mir auf Anhieb sympathisch.
Mein Werk fällt definitiv in die Science-Fiction – und doch ist es so viel mehr.
Ich hatte diese Idee, Okkultismus, Mythologie und etablierte wissenschaftliche Theorien – insbesondere aus der Quantenphysik – in einer universumumspannenden Geschichte zu verknüpfen, die in ihrem Ausmaß die Entwicklung der Menschheit für immer prägen würde. Synchromancer versteht sich also nicht als klassischer Sci-Fi-Roman, sondern verwebt Glaubenslehren, globale Konflikte und gelegentlich eine Prise Humor zu einer facettenreichen Handlung. Entstanden ist eine abenteuerliche, bisweilen vielleicht sogar psychedelische Reise zu den Wurzeln der Menschheit und zu dem bislang verborgenen Geheimnis, wie die Realität tatsächlich beschaffen ist. Wenn ich meinen Roman einem der zahlreichen Subgenres der Science-Fiction zuordnen müsste, würde er wohl zwischen Speculative Fiction, Near Future, Hard Sci-Fi, Science-Fantasy und einem Hauch Dystopie angesiedelt sein.
In meinem Roman lege ich großen Wert darauf, die Grundlagen möglichst plausibel klingen zu lassen. Das betrifft vor allem die Passagen über Physik, aber auch jene über Religion und Mystik. Dadurch wird der Stoff vermutlich etwas anspruchsvoller, gleichzeitig jedoch auch lebendiger und realitätsnäher. Ich mag Details. Denn in ihrer Gesamtheit geben sie einer Geschite Kontur und Tiefe. Meine subjektive Definition von richtig guter, ambitionierter Science-Fiction ist weitgreifend. Kontrovers. Vielschichtig. Komplex. Als Leser – und erst recht als Autor – genügt es mir nicht, wenn Astronauten mit Überlichtgeschwindigkeit durch den Kosmos reisen, durch die Zeit springen oder unerklärliche Portale durchschreiten. Ich will verstehen, wie die zugrunde liegende Technologie funktionieren könnte. Ich muss fühlen, dass sich der Autor etwas dabei gedacht hat und die Prinzipien plausibel sind. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad – schließlich heißt das Genre Science-Fiction.
In Synchromancer ergibt sich die Handlung aus wissenschaftlichen Entdeckungen im Bereich der Quantenphysik, genauer gesagt der Dekohärenztheorie, mit deren Grundlagen sich der Wissenschaftler Erwin Schrödinger (ja genau, der mit der Katze) zeitlebens auseinandergesetzt hat. Niemand soll sich durch die Begrifflichkeiten abschrecken lassen: Die Quantenphysik dient in meinem Roman lediglich als Fundament, um daraus eine verrückte Geschichte zu stricken. Die Dekohärenztheorie erklärt vereinfacht gesagt, warum sich Quantenzustände grundlegend anders verhalten als Phänomene in unserer alltäglichen, klassischen Welt. Für mich als Autor ist das eine wunderbare Ausgangslage, um meine neugierigen Protagonisten auf eine abenteuerliche Reise zu schicken – eine Reise, auf der sie erkennen, dass die Realität viel mehr verbirgt, als sie preisgibt.
Die Quantenphysik bietet dabei wunderbaren Spielraum, um bestehende Theorien aufzugreifen – zumal gerade in diesem Bereich der Wissenschaft noch vieles nicht vollständig verstanden ist.
Mir ist bewusst, dass die Themen Quantenphysik und Mythologie – insbesondere in ihrer Kombination – auch das Spielfeld von Pseudowissenschaftlern und Esoterikern streifen. Leider haben viele dieser Akteure das Feld schamlos gekapert, und nicht wenige Scharlatane verdienen massiv Geld mit fragwürdigen Praktiken wie Quantenheilung und ähnlichem Bullshit. Der Begriff Pseudowissenschaft ist negativ behaftet – und das natürlich zu Recht. Doch wenn es um die Phantastik geht, die in erster Linie der Unterhaltung dient, sehe ich die Pseudowissenschaft als absolut inspirierend. Denn im Grunde ist Science Fiction ja nichts anderes als Pseudowissenschaft. Der große Unterschied besteht darin, dass Pseudowissenschaftler ihre angeblichen Erkenntnisse für bare Münze verkaufen, während ich als Science Fiction Autor lediglich den Anspruch habe, eskapistische Unterhaltung zu bieten.
Ja und wie lässt sich denn jetzt mein Debütroman PHYKAL - Synchromancer beschreiben?
Ganz ehrlich: Seit über einem Jahr versuche ich, einen passenden Pitch für die Kurzbeschreibung zu formulieren – und scheitere dabei jedes Mal kläglich.
Einer meiner Testleser meinte, mein Roman fühle sich an wie eine Mischung aus Dan Browns The Da Vinci Code auf Halluzinogenen und Das fünfte Element für TOOL-Fans.
Damit kann ich leben.
© 2025. All rights reserved.
Mail: kontakt(at)lukschmid.com